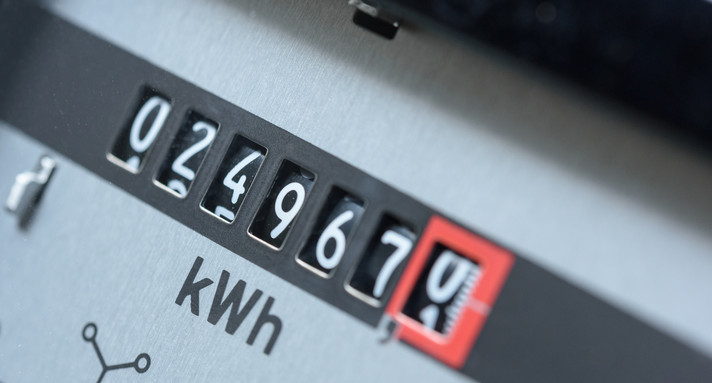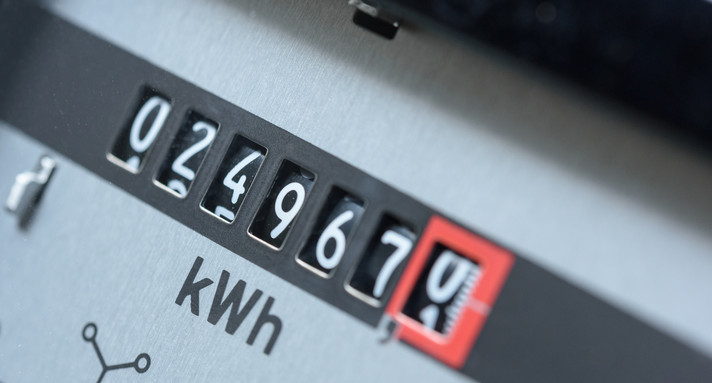Mit den Härtefallhilfen Energie für kleine und mittlere Unternehmen („Härtefallhilfen Energie für KMU 2022 BW“) unterstützte das Land Baden-Württemberg energieintensive kleine und mittlere Unternehmen, die trotz der Entlastungsmaßnahmen des Bundes im Einzelfall von besonders stark gestiegenen Mehrkosten für Energie betroffen waren, um dadurch eine wirtschaftliche Existenzbedrohung abzuwenden. Die Mehrkosten für Energie wurden energieträgerunabhängig berücksichtigt. Das Programm wird aus Bundesgeldern finanziert, wobei das Land die Verwaltungskosten trägt. Die Antragstellung war bis zum 15. Juni 2023 möglich.
Hinweis:
Bitte beachten Sie: Das Privatverbraucherprogramm für nicht-leitungsgebundene Energieträger wie beispielsweise für Heizöl, Pellets oder Flüssiggas fällt in die Zuständigkeit des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Weitere Informationen hier
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung aus Gründen der Billigkeit im Rahmen der Härtefallhilfen Energie für kleine und mittlere Unternehmen – Förderlinie 2022 des Landes Baden-Württemberg
FAQ Härtefallhilfen Energie für KMU 2022 BW (PDF)